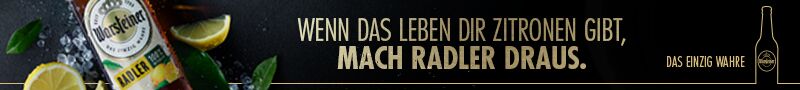Katja Lewina: „Ich will nichts hinterlassen. Ich will jetzt leben.“
Katja Lewina schreibt über das Sterben – und landet mitten im Leben. Als Katja Lewina ihren siebenjährigen Sohn verliert und kurz darauf selbst die Diagnose einer unheilbaren Herzerkrankung erhält, stellt sich ihr eine existenzielle Frage: Wie leben, wenn alles jederzeit vorbei sein kann? Antworten darauf gibt sie in ihrem Buch „Was ist schon für immer“.
Ein Gespräch über Trauer, Freiheit, radikale Ehrlichkeit und die Kunst, das Jetzt nicht zu verschwenden. Ein Appell, sich nicht länger selbst kleinzuhalten, sondern das eigene Leben jenseits von Rollenbildern, Erwartungen und To-do-Listen in die Hand zu nehmen: mutig, erfüllt und frei.
Interview: Gunda Windmüller, Juliane Rump Foto Julija Goyd
Gunda Windmüller: Katja, sterben Frauen eigentlich anders als Männer?
Katja Lewina: Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass Männer öfter einsam sterben. Vor allem, wenn sie Witwer werden, verlieren sie oft ihr soziales Umfeld. Sie vereinsamen, ziehen sich zurück. Wenn jemand nach Tagen tot in der Wohnung gefunden wird, ist es meistens ein Mann. Frauen dagegen können sich häufig besser kümmern – um sich selbst und um ihre Kontakte. Sie sind oft eingebundener, werden begleitet. Das macht einen großen Unterschied.
Gunda Windmüller: Und beim Trauern? Gibt es da auch Unterschiede?
Katja Lewina: Absolut. Frauen kommunizieren tendenziell anders, sind expressiver. Sie reden über ihre Gefühle, holen sich Unterstützung. Männer wurden oft dazu erzogen, alles mit sich selbst auszumachen. Und das staut sich dann. Nicht geweinte Tränen suchen sich andere Ausgänge: Wut, Rückzug, Alkohol. Vielleicht auch chronische Gereiztheit. Alles, nur nicht Schwäche zeigen. Männer drücken weg. Frauen drücken aus.
Gunda Windmüller: In Japan gibt’s diese Zen-Praxis, fünfmal am Tag an den Tod zu denken. Wie findest du das?
Katja Lewina: Gar nicht schlecht. Die meisten von uns verdrängen den Tod ja komplett. Ich hatte mal eine App, die mir täglich schrieb: Don’t forget, you’re going to die. Erst fand ich das cool, irgendwann hat’s mich genervt. Ich dachte: „Ja, danke. Ich bin ja noch da.“ Ich finde: Wir sollten uns lieber mehrmals am Tag daran erinnern, dass wir leben. Und uns fragen: Was will ich mit diesem Tag anfangen?
„Wir brauchen Raum zum Fehler machen, Gammeln, Scheitern. Menschlichkeit eben – keine To-do-Liste des perfekten Lebens.“
Gunda Windmüller: In dem Zusammenhang vielleicht anknüpfend, du schreibst im Buch davon, dass du gegen eine Bucketlist bist.
Katja Lewina: Nicht dagegen. Obwohl doch, ich bin dagegen. Für mich sind Bucketlists ein Symptom dafür, dass jemand sich nicht lebendig fühlt – und dann versucht, das mit spektakulären Erlebnissen zu kompensieren. Ich finde das so absurd – da stehen dann Dinge wie ‚mit Delfinen schwimmen‘ oder ‚Bungee-Jumping‘ drauf. Aber was, wenn du eigentlich einfach nur morgens in Ruhe aufwachen willst? Oder ein gutes Gespräch führen? Ich glaube, viele dieser Punkte sind fremdbestimmte Sehnsüchte, nicht unsere eigenen. Das ersetzt kein echtes Lebensgefühl. Stattdessen lieber ein Leben führen, das sich jetzt echt anfühlt. Dann ergibt sich das Abenteuer von selbst, vielleicht auch mal beim Bungee-Jumping – aber ohne Zwang zum Ankreuzen.
Gunda Windmüller: Das finde ich wirklich auch so lustig, warum wollen Leute eigentlich Bungee-Jumping? Wie langweilig kann man sich denn das Leben wünschen? Und in dem Zusammenhang frage ich mich, müsste man nicht eigentlich sagen, sterben lernen heißt leben lernen?
Katja Lewina: Total. Der Tod relativiert so vieles. Es gibt von Montaigne einen ganz tollen Satz, an dem kralle ich mich auch immer wieder fest, „Wer sterben gelernt hat, versteht das Dienen nicht mehr.“ Wenn man sich bewusst macht, dass der Tod die letzte Grenze ist, wirkt vieles im Leben kleiner – und wird dadurch leichter. Das kann wahnsinnig befreiend sein.
Gunda Windmüller: Du schreibst sinngemäß im Buch: „Das Falsche tun entlastet.“ Was meinst du damit?
Katja Lewina: Dass wir aufhören sollten, uns dauernd selbst zu optimieren. Dieses „Mach das Beste aus deinem Tag“ ist ein Druck, der krank macht. Wir brauchen Raum zum Fehler machen, Gammeln, Scheitern. Menschlichkeit eben – keine To-do-Liste des perfekten Lebens.
Gunda Windmüller: Aber wie geht das – Balance zwischen Leben und Überleben?
Katja Lewina: Ich glaube, viele Menschen leben auf Autopilot. Funktionieren einfach nur. Dabei spüren sie: Das ist nicht mein Leben. Ich glaube, jede*r hat eine Ahnung davon, was sich gut und richtig anfühlt. Es geht nicht um Leistung, sondern darum, sich lebendig zu fühlen. Auch mit Pausen, auch mit Verfehlungen.
Gunda Windmüller: Kannst du den Satz „Je ne regrette rien“ unterschreiben?
Katja Lewina: Oh Gott, nein, ich bereue so vieles. Ich habe so viel Mist gemacht. Wenn man mich heute noch einmal zurückschicken würde in die Vergangenheit, würde ich einiges anders machen. Aber erstens ist es unmöglich, mich in die Vergangenheit zu beamen und zweitens ist es vielleicht auch ganz gut so. Ich glaube, wir alle leben das Leben nach bestem Wissen und Gewissen. Der Satz von Irvin D. Yalom hat mir geholfen, wirklich nach vorn zu denken: ‚Was kannst du heute tun, damit du in fünf Jahren nichts bereuen musst?‘ Nicht: Was hätte ich damals anders machen sollen. Sondern: Was kann ich jetzt tun – für mein zukünftiges Ich.
Juliane Rump: Hat deine Diagnose dich radikaler in deinen Entscheidungen gemacht?
Katja Lewina: Ja. Ich grüble weniger, handle klarer. Wenn ich merke, ich komme an meine Grenze, ziehe ich Konsequenzen. Früher hätte ich weitergemacht. Heute weiß ich: Ich darf auf mich achten. Ich muss mich nicht kaputtarbeiten. Ich fülle meine Zeit mit dem, was mich wirklich glücklich macht. Das fühlt sich sehr erwachsen an.
„Wirklich frei sind wir erst, wenn wir den Gedanken, irgendetwas festhalten zu können, loslassen und uns dem Fluss des Lebens hingeben. Sobald wir aufhören, dagegen anzuschwimmen und uns mittreiben lassen, dann ist das eine großartige befreiende Entlastung.”
Juliane Rump: Was hält so viele davon ab, ihr Leben zu leben?
Katja Lewina: Ganz oft unsere Prägung. Den wenigsten von uns wurde beigebracht, dass wir ein Recht auf Glück haben. Viele wurden klein gehalten, emotional, intellektuell. Da wird dann später ein Leben gelebt, das funktioniert, einem bestimmten Status folgt, aber nicht erfüllt ist. Und irgendwann fehlt der Mut, etwas zu verändern – weil man nie gelernt hat, dass man glücklich sein darf.
Juliane Rump: Würdest du sagen, deine Geschichte hat dich zur „Meisterin des Loslassens“ – z. B. von falschen Überzeugungen – gemacht?
Katja Lewina: Loslassen müssen wir ständig. Sei es irgendwelche Lebensträume oder Beziehungen oder Jobs. Ich weiß nicht, ob man das meistern kann. Aber ich musste es lernen. Gesundheit, Kinder, Beziehungen – nichts bleibt für immer. Ich versuche, mich nicht an etwas zu klammern, was sich eh nicht festhalten lässt. Wirklich frei sind wir erst, wenn wir den Gedanken, irgendetwas festhalten zu können, loslassen und uns dem Fluss des Lebens hingeben. Sobald wir aufhören, dagegen anzuschwimmen und uns mittreiben lassen, dann ist das eine großartige befreiende Entlastung.
Juliane Rump: Keine Bucketlists, keine Lebenszeitverschwendung. Wie steht es mit der Angst, etwas zu verpassen?
Katja Lewina: FOMO ist oft verkleidete Todesangst. Wenn wir uns unserer Endlichkeit nicht stellen, geraten wir in eine unerklärliche Panik: Ich muss noch das und das erleben! Aber je mehr wir uns mit dem Tod aussöhnen, desto weniger hetzen wir durchs Leben. Dann verstehen wir: Ich kann nicht alles sehen, alles können, alles erleben. Ich darf mich entscheiden.
Juliane Rump: Gibt es etwas, das du der Welt unbedingt hinterlassen willst?
Katja Lewina: Viele Menschen wollen so gerne irgendetwas Bedeutendes hinterlassen, dabei ist das völlig irrelevant. Es ist so ein Ego-Ding zu sagen, ich bin dann tot, aber ich lebe weiter in XY. In meinen Büchern oder in diesem tollen Haus, in meinem Vermögen, in meiner Stiftung. Was soll das? Tot ist man dann trotzdem. Ich will eigentlich gar nichts hinterlassen, höchstens dafür sorgen, dass meine Kinder nicht ohne alles dastehen. Ansonsten lebe ich im Jetzt. Ich will ein gutes Leben – mit dem, was ich habe. Und das reicht.
Juliane Rump: Könnte ein anderer Umgang mit dem Tod unsere Gesellschaft verändern und dazu führen, dass Menschen ihr Leben bewusster und erfüllter leben, anstatt unglücklich umherzustreifen?
Katja Lewina: Erstens das. Zweitens glaube ich, dass es auch zu mehr Mitgefühl führen würde. Aber der Tod hat bei uns kein gutes Standing. Wir verdrängen ihn. Alter, Krankheit, Vergänglichkeit – alles das wird weggeschoben. Junge Menschen sehen kaum noch alte Gesichter. Das ist ein Riesenproblem. Ohne Tod kein echtes Leben.
Juliane Rump: Dein Buch wirkt auf mich sehr empowernd – auch durch diesen Satz deines Ex nach dem Tod eures Sohnes, der im ersten Moment verstört und gleichzeitig so kraftvoll ist: „Ich lasse mir davon nicht mein Leben kaputtmachen.“
Katja Lewina: Ja, ich liebe diesen Satz. Er ist radikal, fast schockierend – aber er stimmt. Dinge passieren. Schlimme Dinge. Tragödien. Brüche. Aber wir entscheiden, ob wir darin versinken oder weitermachen. Ich will leben. Nicht, obwohl das passiert ist. Sondern gerade deswegen.
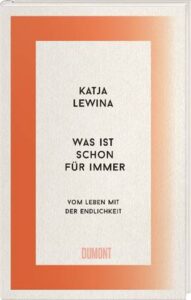
„Was ist schon für immer“ ist ein radikal ehrlicher, zärtlicher und kluger Text über Verlust, Loslassen und Leben – und die große Frage, was bleibt, wenn nichts bleibt.
Ein Reminder an uns alle: sich dem Leben immer wieder neu hinzugeben – gerade dann, wenn es am schmerzvollsten ist.