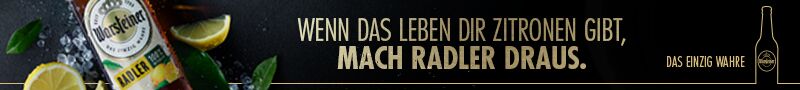Jenseits des Safe Space – Warum queere Räume nicht (immer) reichen
Wie sicher sind queere Räume wirklich? Samson Grzybek schreibt in diesem persönlichen Meinungsstück über Zugehörigkeit, Ausgrenzung – und die Notwendigkeit, komplexer zu werden.
Mein Gym ist eins wie jedes andere. Mein Haarsalon frisiert alle möglichen Leute. Sie bewerben sich nicht explizit als queerfreundlich. Wenn ich in Cafés, Läden oder Buchhandlungen gehe, achte ich kaum noch auf Regenbogensticker am Eingang. Das letzte Mal war ich auf einer queeren Party, weil mich eine befreundete Person direkt eingeladen hat – und das ist Monate her. Ich gehe auf Lesungen, auf die ich wirklich Lust habe – und für die ich am selben Tag noch Spoons übrig habe. Kurz: Mittlerweile suche ich kaum noch explizit queere Spaces auf.
There, I said it.
Bin ich ein schlechtes Beispiel für meine eigenen Communities? (Anmerkung: Ich sehe aufgrund der unterschiedlichen Lebensrealitäten und Kämpfe keine einheitliche queere Community, sondern spreche von den Communities, in denen ich mich wiederfinde.)
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich müde bin.
Müde von queeren Räumen, in denen Rassismus und Ableismus keine Rolle mehr zu spielen scheinen. In denen sich finanziell privilegierte Queers selbstverständlich für Abschiebungen oder Asylrechtsverschärfungen aussprechen. Und trotzdem keine Regung zeigen, wenn BIPoCs angegriffen werden. In denen transfeindliche Kommentare hingenommen werden, weil alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ich bin müde von der Einstellung, dass man automatisch nicht diskriminierend sein kann, nur weil man selbst Diskriminierung erlebt hat.
Ich habe an meinem Wohnort kaum Orte gefunden, an denen intersektionale Realitäten wirklich gesehen werden – ohne dass Diskriminierung relativiert oder ignoriert wird. Ich habe es versucht. Ich habe so einen Raum selbst zu schaffen versucht. Queer und PostOst. Aber auch da: viel Energie, wenig Resonanz. Ein Gruppenchat, der irgendwann nur noch stille Punkte anzeigt. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass meine Realität nicht in einen einzelnen Raum passt. Sondern auf viele Orte verteilt ist.
Vielleicht muss ich akzeptieren, dass meine Realität nicht in einen einzelnen Raum passt
Was mir fehlt: die Anerkennung von Komplexität. Vor allem jenseits von Berlin oder Hamburg. Vielleicht ist mein Blick begrenzt, mein Algorithmus nicht auf meinen Wohnort abgestimmt.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass viele queere Spaces sich inzwischen so etabliert haben, dass es für ein vages Gefühl von Sicherheit reicht. Und niemand mehr genau hinsieht. Viele konzentrieren sich doch nur auf einen Punkt: das Queersein.
Aber: Ich will mich nicht verstecken müssen. Ich will hingehen, wo ich will. So wie es Menschen tun, die sich für „normal“ halten. Ich leiste Bildungsarbeit. Regelmäßig. Kostenlos. Ich erkläre Dinge, die man selbst nachlesen könnte. Und trotzdem will ich mich auch dort wohlfühlen, wo ich erklären muss.
Über die Jahre merke ich, dass sich etwas verändert. Gespräche laufen anders. Sprache verschiebt sich. Ich stelle Fragen, die etwas auslösen. Die Gesprächspartner*innen reagieren. Ihre Körper kommen in Bewegung, ihre Gedanken auch – und arbeiten weiter.
Ohne dass ich darum bitten musste, wurde mein Name in den Systemen meines Gyms und meines Haarsalons geändert. Weil es den Inhaberinnen wichtig war. Weil sie es gesehen haben. Auf Instagram. Und gefragt haben. So einfach könnte es sein, oder? Wenn wir nicht nur auf unser eigenes Wohl achten, sondern auf das kollektive.
Mich stört der Rassismus in vielen queeren, meist weißen Räumen. Mich stört der Ableismus. Mich stört, wie selten Kapitalismus und Klassismus Thema sind. Mich stört die Idee, dass marginalisierte Menschen automatisch bessere Menschen seien. Und ja: mich stört auch die Überheblichkeit weißer Cis-Heteros, die „Ist DAS schon Diskriminierung?“ sagen, nachdem sie ein Klischee reproduziert haben – und grinsen. Wir leben in einer Welt, die von Machtstrukturen getragen wird. In der Unterdrückung Produktivität erzeugt. In der Profit aus Hass geschlagen wird. „Mir geht es gut, solange ich mehr habe als der andere.“
Es ist anstrengend, diese Gespräche zu führen. Es ist anstrengend, immer wieder etwas zu sagen, wenn ein Spruch nicht okay ist. Egal, in welchem Raum. Und trotzdem: Ich will etwas sagen. Wenn etwas Queerfeindliches, Rassistisches, Ableistisches oder Antisemitisches geäußert wird. Ich will Menschen auf ihre Klassenprivilegien hinweisen. Auf ihre Sprache. Auf die Wirkung, die sie erzeugen.
Und das kann ich nicht in einem vermeintlichen „Safe Space“, der Diskriminierung duldet. Ein Ort, der wegsieht, ist kein sicherer Ort. Egal wie bunt der Sticker an der Tür ist. Ich will meine Kraft für Gespräche nutzen, die zählen. Auch wenn sie draußen stattfinden. Auch wenn kein Regenbogen im Fenster klebt. Auch wenn die Menschen dort meine Lebensrealität nicht teilen. Aber sie wollen zuhören.
Und zuhören ist heute radikal. Wie wollen wir Allyship, wenn wir Grenzen ziehen? Wenn wir nur sagen: Ihr müsst euch ändern. Menschen schreiben mir. Online, offline. Sie lesen meine Texte. Sie verstehen mehr. Und sie werden wütender. Und handlungsbereiter. Individuell reicht das nicht. Aber es ist ein Anfang. Wie wollen wir Solidarität, wenn wir Angst haben, im nächsten Moment ausgeschlossen oder verletzt zu werden? Wenn wir dem Schmerz anderer keinen Raum geben – besonders dann, wenn wir ihn verursacht haben?
Es geht nicht darum, alles totzudiskutieren. Während wir reden, handeln andere. Rechte Gruppen finden ihren Konsens. Schnell. Laut. Demokratie beginnt nicht auf dem Wahlzettel. Sondern vorher. In Gesprächen. In Blicken. Im Dableiben.
Wenn wir zuhören. Und nicht wegsehen.
Text: Samson Grzybek Foto: Jana Rodenbusch
Samson Grzybek ist Autor*in, Lyriker*in, Speaker*in und Gründer*in von Queermed Deutschland – einer Plattform für diskriminierungssensible Gesundheitsversorgung und queere Safer Spaces.
Mit Queermed setzt sich Samson als nonbinärer Aktivist*in für mehr Awareness in medizinischen Strukturen ein – durch Vorträge, Workshops, Blogbeiträge und Bildungsformate. Schwerpunkte sind u. a. queere Lebensrealitäten, Trauma, Klassismus, Herkunft und Machtverhältnisse.
Samsons Texte erscheinen auf dem Queermed-Blog, in Newslettern sowie Magazinen wie Veto oder Teenstark. Im Podcast „Trauerschatten“ spricht Samson mit Gäst*innen über persönliche Trauererfahrungen – einfühlsam, politisch und offen. Mehr über Samson Grzybek erfahrt ihr hier.