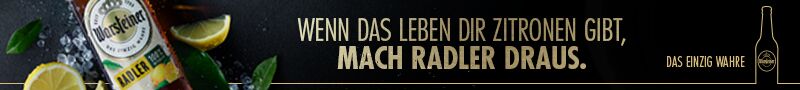Von Witches zu It-Girls — das Patriarchat ist quicklebendig
Rebekka Endler zeigt in „Witches, Bitches, It-Girls“, wie uralte patriarchale Erzählungen im neuen Gewand zurückkehren. Mit fundierter Recherche, Humor und Klarheit seziert sie die Mechanismen, die Frauen, queere Menschen und marginalisierte Gruppen kleinhalten. Das Ergebnis ist ein umfangreiches feministisches Werk, das Geschichte, Popkultur und Politik zu einer detaillierten Analyse verbindet – und zeigt, dass Widerstand nicht nur nötig, sondern möglich ist.
Von Pandora bis zur Rape Culture: Patriarchale Narrative sind tief in unsere Kultur eingeschrieben. Wie tief, das verdeutlicht Rebekka Endler mit ihrem aktuellen Buch „Witches, Bitches, It-Girls“: Bei den Ursprungsmythen – Pandora, Eva, die Hexen – beginnend, zeigt sie, wie diese Frauenfiguren seit jeher als Projektionsflächen dienen, auf denen Schuld, Begierde und Strafe verhandelt werden. Was einst als religiöse oder mythische Erzählung galt, kehrt in neuer Form in den Diskursen über „Huren“ und „Bitches“, über das „It-Girl“ oder die „falsche Feministin“ wieder. Das Muster bleibt: Frauen und queere Personen werden nicht nur dargestellt, sondern auf bestimmte Rollen festgelegt, die meist mit Sünde, Gefahr oder Lächerlichkeit verbunden sind.
Von hier aus entwickelt die Autorin ihre Analyse der „Normalität“ als Herrschaftskategorie. Was als selbstverständlich gilt, ist nicht neutral, sondern immer Ergebnis von Definitionsmacht. Wer als „normal“ markiert wird, muss sich nicht erklären; wer davon abweicht, muss seine Existenz rechtfertigen. Anhand von Körperbildern, Schönheitsnormen und medizinischen Klassifikationen zeigt Endler, wie eng patriarchale Ordnung mit rassistischen, ableistischen und klassistischen Strukturen verwoben ist – ein Geflecht, das nicht nur ausgrenzt, sondern auch reale Gewalt legitimiert.
Eindringlich beschreibt sie, wie die Rape Culture unsere Gegenwart prägt. Serien, True-Crime-Formate und Filme ästhetisieren Gewalt gegen Frauen, machen sie konsumierbar – und verschleiern zugleich die systemische Dimension dieser Gewalt. Der männliche Blick, der sogenannte male gaze, ist dabei nicht bloß eine ästhetische Kategorie, sondern ein politisches Werkzeug, das Opfer selektiert und ganze Gruppen unsichtbar macht. Scharf analysiert Endler hier den Mythos der „falschen Beschuldigung“, der immer dann hervorgeholt wird, wenn Frauen oder queere Menschen über erlebte Gewalt sprechen:
„Die Angst vor der Falschbeschuldigung ist ein mächtiger Mythos, dessen Erzählkraft uns seit Jahrzehnten immer wieder und überall begegnet und wie eine Waffe gegen Berichte von Opfern gerichtet wird.“
Damit zeigt sie, wie perfide Narrative wirken: Sie schützen nicht die Opfer, sondern die Täter – und stabilisieren so das patriarchale Machtgefüge.
Auch unbequeme Themen innerhalb feministischer Bewegungen werden von Rebekka Endler deutlich benannt. Mit klarem Blick beschreibt sie die Spaltungen, die durch transfeindliche Rhetorik oder TERF-Ideologien befeuert werden, und zeigt, wie diese Bruchlinien antifeministischen und rechten Kräften in die Hände spielen. „Transfeindlichkeit“, so ihre Diagnose, sei „die goldene Eintrittskarte in die sogenannte bürgerliche Mitte“ – eine Erkenntnis, die verdeutlicht, wie gefährlich es ist, wenn Feminismus instrumentalisiert oder exklusiv gedacht wird.
Was das Buch so überzeugend macht, ist die Art, wie Endler historische Tiefenbohrungen mit aktuellen politischen Entwicklungen verknüpft. Sie verweist auf globale Anti-Gender-Netzwerke, auf reaktionäre Allianzen zwischen religiösen Fundamentalisten, Oligarchen und populistischen Politiker*innen, die den Kampf gegen „Gender“ als Spaltpilz nutzen. Gleichzeitig entlarvt sie die Nostalgie nach einer vermeintlichen „Normalität“ als politisches Lockmittel – den Rückgriff auf eine Vergangenheit, die es so nie gab, die aber als Fantasie so wirkmächtig ist, dass sie repressive Politiken legitimiert.
Trotz der Schwere der Themen ist Endlers Sprache nie sperrig. Mit Ironie, Popkultur-Referenzen und spitzer Beobachtung macht sie ihre Entlarvung zugänglich, ohne an analytischer Schärfe einzubüßen. Gerade dieser Tonfall, der zwischen Empörung, Witz und Präzision changiert, macht die Lektüre nicht nur zugänglich, sondern auch ermutigend. Wer sich schon länger mit patriarchalen Strukturen auseinandersetzt, wird viele Aha-Momente haben, und wer neu dabei ist, bekommt einen packenden Einstieg, der Lust auf Weiterdenken und Handeln macht.
Am Ende bleibt ein klares Fazit: Das Patriarchat ist kein Relikt, es ist quicklebendig – anpassungsfähig, vielgestaltig, global vernetzt. Doch Endlers Buch ist mehr als eine Diagnose. Es ist eine Aufforderung, diese Mechanismen nicht nur zu erkennen, sondern ihnen aktiv etwas entgegenzusetzen. Und es erinnert uns daran, dass Hoffnung – um im Bild der Pandora zu bleiben – nicht einfach am Boden einer Büchse liegt, sondern immer wieder neu erkämpft werden muss.
Text: Juliane Rump Foto: Andrew Collberg