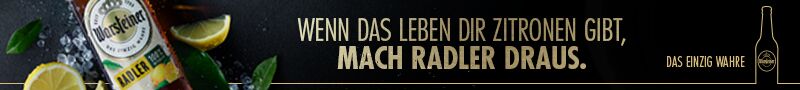Das Märchen von der unglücklichen Singlefrau
Wer die 30 überschritten hat und Single ist, kennt die vielen wohlmeinenden Ratschläge aus dem Familien- und Freundeskreis: „Das wird schon noch“, „Du musst dich mal etwas locker machen“, „Vielleicht hast du zu hohe Ansprüche?!“ Singlefrauen, so scheint es, brauchen Nachhilfe in Lebensführung. Dabei liegt das Problem nicht bei den Singles. Sondern bei einer Gesellschaft, die es Frauen nicht zutraut, auch alleine glücklich zu sein.
Wer bin ich? Diese Frage möchten wir eigentlich gerne selbst beantworten, aber oft genug beantworten andere sie für uns. Noch öfter, wenn wir Frauen sind. Und nochmal öfter, wenn wir Single sind.
Denn dann wird unser Beziehungsstatus schnell zum ultimativen Gradmesser, zum Filter, ohne den unser Umfeld unser „Ich“ gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ein Filter, der sich über alles legt, was uns sonst so ausmacht. Und die Antwort auf „Wer bin ich?“ eindeutig gibt: zumindest nicht komplett.
Beziehungsstatus als Filter auf das Ich
Nicht komplett, und vor allem auch nicht glücklich. Eine beeindruckende Karriere wird dann schnell zur verbissenen Leistungsschau. Ein Urlaub mit Freundinnen zum übertriebenen Geldverschleiß. Ein reges Sexleben zur tragischen Suche nach Intimität. Singles, so die Vorstellung dabei, KÖNNEN ja gar nicht wirklich zufrieden sein. Denn zum Glück, zum vollständigen Frau-Sein, fehlt ihnen eben etwas: die romantische Beziehung, ohne die selbst ein eigentlich wunderbar glückliches Leben nur als leere Hülle wahrgenommen wird.
Sicher, auch Singlemänner kassieren hin und wieder privat mitleidsvolle Seitenhiebe wegen ihres Beziehungsstatus, aber geht es um die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung, wird ihnen das Glück immerhin noch zugetraut. Hollywood-Schauspieler dürfen sich als Singles für ihr abwechslungsreiches Liebesleben beneiden lassen, während ihre Kolleginnen sich als „arme Jen“ (Aniston) und tragisch Verlassene bemitleiden lassen müssen. Und ist ein Politiker eigentlich schon mal gefragt worden, ob ihm „die Frau“ zur Macht fehlt? Bei alleinstehenden Politikerinnen hingegen wird gerne schnell vermutet, dass ihnen eine starke Schulter zum Anlehnen fehlt. Irgendwas fehlt ihnen immer.
Oje, Singlefrauen. Sie sind ganz schön tragisch. Außerdem egoistisch, kapriziös, zu anspruchsvoll. Sie stopfen emotionale Lücken mit Konsum und viel zu viel Prosecco. Sie sind Mängelwesen. Fortwährend auf der Suche und in anderen Lebensbereichen kompensierend. Oder?
Natürlich nicht. Aber als Singlefrau fällt es eben schwer, durch diesen von außen auferlegten Filter des Ungenügens ein anderes Ich durchscheinen zu lassen. Ein Ich, das nicht vornehmlich vom Beziehungsstatus geprägt wird. Wer dieses Ich dennoch betont und sich zudem noch herausnimmt, sich als „weiblich, ledig UND glücklich“ zu bezeichnen, wird oft genug nicht ernst genommen. Frei nach dem Motto: „Die Arme, sie kann es sich nicht eingestehen.“
Arm dran – aber warum eigentlich?
Single Shaming, wie ich diese negative Stereotypisierung nenne, hat eine lange Geschichte. Fangen wir mal mit der Liebe an. Die Liebe wird oft als ewiges Gefühl beschrieben; ein Gefühl, welches historischen Veränderungen trotzt und uns seit Menschheitsbeginn unverändert begegnet. Und klar, Menschen lieben sich schon seit ewigen Zeiten. Aber die Verbindung von Liebe und fester Zweierbeziehung ist ziemlich neu. Sie ist erst ein paar hundert Jahre alt.
Dieses Beziehungsmodell ist auch nicht zufällig entstanden, die wirtschaftliche Entwicklung forderte es ein. Im 19. Jahrhundert setzt sich die Industriegesellschaft durch, parallel dazu werden die Geschlechterrollen verstärkt. Was typisch weiblich und typisch männlich ist, entsteht damals aus einer ideologischen Notwendigkeit heraus: der Kleinfamilie. Der Mann als der eigenständig kraftvolle Alleinverdiener, die Frau als sanftmütig fürsorgende Mutter und Hausfrau. Die Industriegesellschaft ist auf diese Rollenverteilung angewiesen. „Ohne Trennung von Frauen- und Männerrolle keine traditionale Kleinfamilie. Ohne Kleinfamilie keine Industriegesellschaft in ihrer Schematik von Arbeit und Leben“, schreibt der Soziologe Ulrich Beck. Soviel zur Romantik.
Kleinfamilie und Industriegesellschaft
Was hierbei zudem entsteht, ist die Vorstellung von einer festen, exklusiven und heterosexuellen Partnerschaft als etwas Natürlichem; etwas Normativem, etwas, das sein SOLL. Wer sich also außerhalb dessen bewegt, wird schnell als unpassend wahrgenommen. Als unpassend und irgendwie nicht ganz komplett. Für Frauen gilt das ganz besonders, denn außerhalb einer Beziehung, so die Vorstellung, können wir eben unsere vermeintlich natürlichen Eigenschaften nicht richtig ausleben. Die Fürsorge, das Schutzbedürfnis, die Mütterlichkeit. Was Frauen halt so ausmacht.
Dabei wird allerdings geschickt verschleiert, dass es gerade Frauen sind, die in dieser traditionalen Kleinfamilie den Kürzeren ziehen. Das hat schon Simone de Beauvoir beschrieben: „Die Ehe bietet sich dem Mann und der Frau stets grundverschieden dar.“
Grundverschieden, und wie!
Denn durch dieses Konzept werden vor allem sozioökonomische Hierarchien zementiert. Und das ist auch heute noch so. Frauen in heterosexuellen Beziehungen verdienen weniger, sie machen mehr im Haushalt: „Alle Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, daß Hausarbeit in den Kernbereichen nach wie vor überwiegend von Frauen verrichtet wird. Dies gilt auch für neuere Untersuchungen, für Familien, in denen die Frau teilzeit- oder vollzeiterwerbstätig ist … und auch für Familien mit einer Arbeitsteilung, die sie selbst für egalitär halten“, schreiben die Soziologin Cornelia Koppetsch und der Soziologe Günter Burkart.
Solche Beziehungen, rein wirtschaftlich gesprochen, lohnen sich für Frauen also nicht. Und doch sind es Frauen, die eher Mitleid kassieren, wenn sie nicht in einer solchen Beziehung, wenn sie Single sind. Diesen Zustand könnte man für paradox halten, wenn er nicht sehr clever dazu verhelfen würde, Frauen in diesem Rollenbild festzutackern. Denn warum sollten sich Frauen sonst auf ein für sie so nachteiliges Modell einlassen, wenn das große Liebe-Versprechen ihnen nicht die Vervollkommnung versprechen würde? Wie es die Soziologin Eva Illouz in „Warum Liebe weh tut“ beschrieben hat: Liebe wird in der Moderne ein zentraler Bestandteil des weiblichen Selbstwerts, wenn uns die Liebe also fehlt, bleiben wir unvollständig.
Für einen neuen Selbstwert!
Aber es ist nun mal 2020. Höchste Zeit, andere Parameter für unseren Selbstwert einzufordern und unser Privatleben von angestaubten Rollenbildern zu befreien. Dem Rollenbild der tragischen Singlefrau zum Beispiel. Denn wer sind wir? Wir sind ganze Menschen. Und zwar unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Unabhängig davon, ob unsere Gebärmutter zum Einsatz gekommen ist oder ob wir einen Ring am Finger tragen.
Nach Jahrhunderten der Aufopferung kann uns das Single-Sein nämlich auch etwas eröffnen: eine Ära der weiblichen Selbstbestimmung. Eine Ära, in der uns Beziehungen (Plural) ausmachen und in der die Adjektive weiblich und glücklich, in welcher Konstellation auch immer, unhinterfragbar zusammenpassen.
Text: Gunda Windmüller
Mehr von Gunda Windmüller: „Weiblich, ledig, glücklich – sucht nicht“